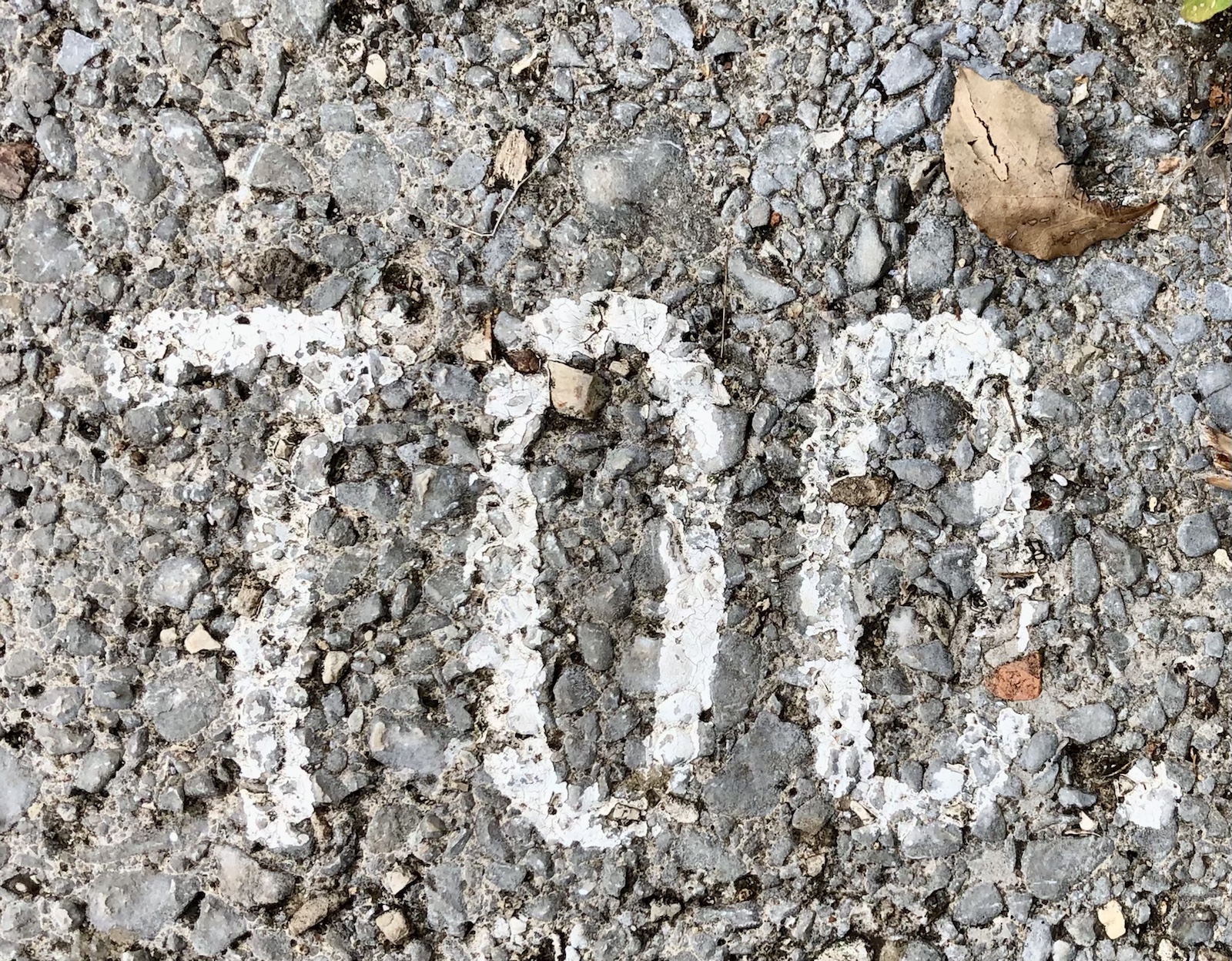Varoš liegt nur etwa zwei Kilometer von unserem Campingplatz entfernt und Teresa, die den kleinen Laden auf unserem Campingplatz betreibt und über alles, was auf Ugljan läuft, Bescheid weiß, hat uns gesagt, da müssen wir hin. Das Örtchen veranstaltet zum Saisonausklang jedes Jahr ein Fest, und das sollte man erlebt haben. Wir hören auf Teresa. Denn Teresa weiß, wo es den frischesten Fisch und das beste Olivenöl gibt. Und wenn man zur Fischfrau geht und einen Gruß von Teresa ausrichtet, packt die einem den Fisch ein, der eben nicht aus der Fischzucht kommt. Mountainbiketrail? Teresa fährt selbst auch und hat die richtigen Tipps parat … Also: Teresa hat unbedingt das Fest in Varoš empfohlen, und deswegen ist der Flecken auch unsere erste Station auf einer Radtour in den Süden der Insel. Wir kommen gegen 11.30 Uhr an, die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Das obligatorische Schweinchen gart auf dem Grill vor sich hin, in einem Topf schmort Fleisch mit verschiedenen Zutaten, ebenfalls über dem offenen Feuer. Hmm …




Kaum haben wir unsere Räder abgestellt, kommt ein Bär von Mann auf uns zu, begrüßt uns freundlich und fragt uns, was wir trinken möchten. Da wir noch Radfahren wollen, rät er, Mlade, uns zu „Gemischt“, also einer Weißweinschorle. Er wisse aus Erfahrung, dass Bier und Radfahren nicht so kompatibel seien. Er sei auch viel mit dem Rad unterwegs. Er muss dann aber auch gleich weiter; bezahlen lässt er uns nicht. Was für ein herzlicher und unkomplizierter Empfang von fremden Menschen.
Kurz darauf kommen wir mit einer jungen Frau ins Gespräch. Sie heißt Jelena und arbeitet als Kellnerin in einem Restaurant. Sie spricht sehr gutes Englisch. Es stellt sich heraus, dass sie eigentlich von Beruf Grundschullehrerin ist. Sie ist Serbin und hat keine Hoffnung auf eine adäquate Anstellung in ihrem Land. Viele junge Leute gingen weg aus Serbien, weil sie dort keine Zukunft hätten, meint sie. Auf dem Festland in Kroatien sei es für Serben schwierig, Arbeit zu finden, aber auf der Insel sei es einfacher. Wir fragen sie, warum sie es nicht als Lehrerin in Kroatien versuche, das sei doch von der Sprache her kein Problem, und die Ausbildung sei doch wahrscheinlich vergleichbar. Nein, lächelt sie verlegen, das habe sie sich nicht getraut. Sie könne sich auch nicht vorstellen, dass man sie als Serbin einstellen würde. Sie müsse jetzt auch los zur Arbeit. Sie bedankt sich etwas überschwänglich für das Gespräch, setzt sich aufs Fahrrad und radelt davon. Hinten auf dem Rucksack weht ihre weiße Bluse im Fahrtwind, die wohl Teil ihrer Berufskleidung ist.
Wir gehen noch ein wenig herum, studieren ein handgeschriebenes Plakat, das im Zusammenhang mit einer Tombola steht. Jedes Geschäft, ob klein oder groß, hat einen Preis ausgelobt: ein Essen in einem Restaurant, ein paar Liter Olivenöl, eine Übernachtung …

Man läuft sich langsam für das Fest warm. Wir machen uns nach einer knappen Stunde wieder auf den Weg.
Auf den Rückweg, gegen fünf Uhr, schauen wir noch einmal in Varoš vorbei. Schon von weither dröhnt uns die Musik entgegen. Wir wollen noch etwas essen. Es ist schwierig, eine Bestellung aufzugeben, das geht nur schreiend und mit Zeigen, so laut ist die Mucke. Der DJ spielt kroatische Schlager, die offenbar alle kennen, Jung und Alt, fast alle singen mit, es wird in kleinen Gruppen getanzt, zumeist Frauen.
Kaum haben wir uns an einen freien Tisch gesetzt, steuert Mlade wieder auf uns zu. Er kenne uns doch … Jetzt fällt’s ihm wieder ein. Er war den ganzen Tag hier. Mittlerweile ist seine Frau auch dabei, die beiden setzen sich zu uns. Auch ihre beiden Töchter, Anfang zwanzig, sind auf dem Fest. Wir unterhalten uns. Die Familie stammt aus Zagreb und hat seit vielen Jahren ein Haus auf Ugljan. Wir reden über die Familie, vor allem die Kinder. Mlade berichtet, dass er leidenschaftlich gerne Rad fährt, bis zu 150 Kilometer am Tag. Unglaublich. Das ist auch deshalb besonders beeindruckend, weil Mlade keine Hände mehr hat. Die habe er im Krieg Anfang der Neunzigerjahre verloren, sagt er. Das ist sicher eine Verstümmelung, an der man verzweifeln kann. Aber Mlade sagt, das sei vor allem eine Kopfsache, eine Frage des Willens. Er gehe immer davon aus, dass er grundsätzlich alles tun könne, er empfinde keine wirklichen Einschränkungen. Manches sei für ihn schwieriger als für andere, und natürlich sei er in bestimmten Situationen auf Hilfe angewiesen. Aber er lasse es nicht zu, dass seine Kriegsverletzung sein Leben bestimme. Wir sind von diesem sympathischen und frohgemuten Mann mehr als nur beeindruckt.

In den folgenden Tagen ist Mlade immer wieder Thema in den Gesprächen zwischen Eva und mir. Wie kommt er wohl mit den vielen kleinen Herausforderungen des Alltags zurecht? Wie wäscht er sich, wie isst er, wer führt kleine Reparaturen im Haus aus? Und wie würde man selbst mit einem solchen Schicksalsschlag umgehen?
Wer viel reist und die Begegnung mit anderen Menschen sucht, erlebt auch mehr dieser Zufallsbegegnungen, die im besten Fall zum Nachdenken über das eigene Leben anregen. Das kann mal ein kurzer Moment sein, eine Beobachtung oder Wahrnehmung anderer Art, oder auch ein intensiver Austausch. Sie gehören auf jeden Fall zu den kleinen Perlen, die das Leben zum Leuchten bringen.